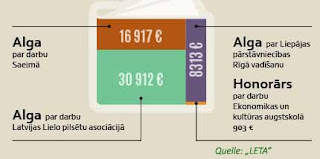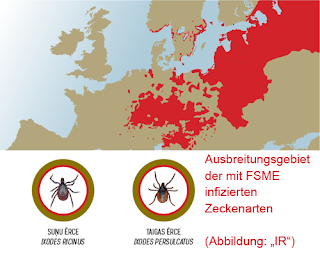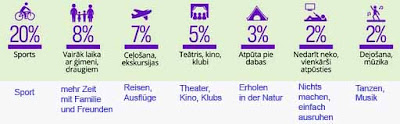Die Vergabe des Hannah-Arendt-Preises ist in der Regel eine sehr seriöse Veranstaltung. Seit 1995 wird dieser Preis verliehen - mit dem Zusatz "für politisches Denken" versehen. Die ungarische Philosophin Agnes Heller hat ihn bekommen, der deutsch-iranische Schriftsteller und in diesem Jahr auch Träger des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels, Navid Kermani, auch der ukrainische Schriftsteller Juri Andruchowytsch. 2005 war es Vaira Vīķe-Freiberga, damals noch als Präsidentin Lettlands im Amt.
Als sie am 16. Dezember 2005 im Festsaal des Bremer Rathauses ihre Dankesrede hielt, konnte sie nicht sicher sein, wie viel der deutschen und der bremischen Öffentlichkeit über Lettland bekannt war. Zudem sagte sie damals, fast entschuldigend, sie sei den größten Teil ihres Lebens kein besonders politisch denkender Mensch gewesen - bis Lettland wieder frei und unabhängig wurde (siehe Preisträgerrede). Die Preisverleihung war damals fokussiert auf zwei Hauptthemen: die Ambivalenz des 8.Mai 1945, für die einen Tag der Befreiung, für die anderen - wie Ralf Fücks es in einem Grußwort formulierte - "geprägt durch die Doppelerfahrung von nationalsozialistischer und stalinistischer Herrschaft". Als zweites Thema redete 2005 natürlich jeder von Europa - und von Vīķe-Freiberga als große Mentorin der Europa-Orientierung ihres Landes. Außerdem war noch nicht ganz verklungen, dass Vīķe-Freiberga damals am 9.Mai als einzige der drei baltischen Präsidenten nach Moskau fuhr und die Einladung Putins zur Ehrenparade annahm.
Am 4.Dezember 2015 waren Heller, Kermani, Andruchowytsch und Vīķe-Freiberga erneut im Bremer Rathaus anzutreffen - zum 20.Jubiläum der Gründung des Hannah-Arendt-Preises hatte der Trägerverein, der Senat der Hansestadt, zusammen mit Heinrich-Böll-Stiftung und Institut Francais zum sortierten Nachdenken eingeladen, unter dem etwas reißerischen Titel "Welt in Scherben".
Im Verlauf zeigte sich, dass auch 10 Jahre nach der Erweiterung von EU und NATO noch immer Kommuni-kationshilfen nötig sind zwischen Ost und West. Auch wenn sich die lettische Ex-Präsidentin zunächst aufgeräumt und locker zeigte. In Zeiten, wo wieder große Flüchtlingsströme durch Europa ziehen, begann "VVF" nur allzu gern bei ihren Erfahrungen als lettischer Flüchtling in Deutschland; sie bat das Bremer Publikum um Verständnis, wenn "diese alte Dame" so eine "Kindersprache" spreche, was ihre Deutschkenntnisse angehe. "Ich bin im Jahre 1945 mit 7 Jahren in Deutschland angekommen, und im Alter von 11 Jahren sind wir damals nach Marokko und später nach Kanada gegangen. Mein Wortschatz ist leider nicht auf derselben Ebene wie mein Verständnis von Deutsch."
"Was ich als Kind gesehen habe, war nur Krieg, und Macht, und nicht Recht," gibt Vīķe-Freiberga zu Protokoll. Es gibt Erinnerungen, die sie bis heute prägen, und offenbar hindert sie nichts, den Deutschen von Deutschland zu erzählen: "Wenn wir heute von einer schwierigen Situation sprechen - direkt nach dem Krieg galt das besonders für Deutschland. Vom Flüchtlingslager in Lübeck sind wir mit dem Zug nach Hamburg gefahren, und ich habe gefragt: wann kommen wir endlich an? Die Antwort war: seit einer halben Stunde fahren wir schon durch Hamburg."
Ihr Fazit: "Das einzige, was ich schon immer gewußt habe ein Recht darauf zu haben ist, Lettin zu sein." Solch ein Satz erweckt erst Beifall unter den deutschen Zuhörern als sie fortfährt: "Die Letten sagten zu mir 'Ja, du bist eine von uns!' - allerdings auch der König von Marokko. Als ich dort einen Staatsbesuch machte, wo wir einmal in Marokko gewohnt hatten, da warteten Tausende von Menschen, und auch sie sagten: 'Wir sind so froh, das einmal eine von uns Präsidentin eines anderen Landes werden konnte!'"
Distanz zum Nationalstolz, eine der Grundvoraussetzungen offenbar für das, was sich in Deutschland ein "kritisches Bewußtsein" nennt. Andererseits war diesmal weder Lettlands sehr zögerliche Haltung zur aktuellen Flüchtlingsproblematik, noch die Frage des Zusammenlebens von Letten und Russen ein Thema. Dany Cohn-Bendit, keiner der Ex-Preisträger, aber geladener Podiumsgast zum Thema "Menschenrechte versus Selbstbestimmungsrecht der Völker" (Zitat: "Ich leide an Europa"), fühlte sich offenbar berufen genug um Frau Präsidentin zu ermahnen, den lettischen Anteil am Holocaust an den Juden stärker kritisch zu beleuchten. Eigentlich auch in Lettland kein Tabuthema mehr - und noch 2005 (anläßlich der Bremer Preisverleihung an die Präsidentin) hatten sich sowohl die jüdische Gemeinde in Riga wie auch Margers Vestermanis, Historiker und Holocaust-Überlebender, positiv zu Vīķe-Freiberga's Initiativen zur Aufarbeitung von Nazi-Herrschaft und Holocaust geäussert.
An dieser Stelle fehlte es Frau Ex-Präsidentin etwas an "Centenance", wie man vielleicht sagen könnte. Etwas gar zu verbissen meinte sie nun den "roten Dany" als "Marxist" entlarven zu müssen - was dieser lachend, die Publikumsgunst auf seiner Seite wissend, zurückwies. Kein Paradebeispiel hoher Diskussionskultur - und wie viel Cohn-Bendit abseits der allgemeinen Schlagzeilen wirklich von Lettland weiß - oder sich überhaupt für dieses Land interessiert - blieb ebenfalls offen. Vīķe-Freiberga verstieg sich noch darin, Cohn-Bendit auf die jüdische Beteiligung am Stalinistischen Regime 1939/40 hinweisen zu wollen - hier wurde es fast peinlich, hatte sie doch noch in ihrer eigenen Amtszeit die lettische Historikerkommission ins Leben gerufen, welche die Verbrechen der beiden totalitären Regime in Lettland aufarbeiten soll; über Gerüchte und Verleumdungen gegen Juden ist in den seither jedes Jahr regelmäßig publizierten Kommissionsberichten genügend nachzulesen. Einem schräges Argument ist eben nicht mit einem noch schrägeren Argument zu begegnen - in sofern war der 4.Dezember im ex-präsidialen Tagebuch sicher kein Termin qualitativ hochstehender Diskussion über Lettland damals und heute.
Sehr wechselhaftes Diskussionsniveau also im Bremer Rathaus - der Abstand zur lettischen Innenpolitik ist offenbar nicht so groß; noch nach dem Rücktritt des damaligen Regierungschefs und jetzigem EU-Kommissars Valdis Dombrovskis gab es eine in Umfragen merkbare Anzahl Menschen, die Vaira Vīķe-Freiberga auch als Regierungschefin für tauglich halten - wohl angesichts des Angebots an sonstigen Alternativen. Zwei Tage nach der Bremer Veranstaltung trat in Lettland Laimdota Straujuma zurück. Nein, die immer noch parteilose Ex-Präsidentin wird wohl kein Allheilmittel sein, solange es in Riga vor allem um interne Ränkespiele geht.
 |
| Vaira Vīķe-Freiberga, Imants Freibergs - im Gespräch mit Antonia Grunenberg |
Am 4.Dezember 2015 waren Heller, Kermani, Andruchowytsch und Vīķe-Freiberga erneut im Bremer Rathaus anzutreffen - zum 20.Jubiläum der Gründung des Hannah-Arendt-Preises hatte der Trägerverein, der Senat der Hansestadt, zusammen mit Heinrich-Böll-Stiftung und Institut Francais zum sortierten Nachdenken eingeladen, unter dem etwas reißerischen Titel "Welt in Scherben".
 |
| Dany Cohn-Bendit, György Dalos, VVF, Juri Andruchowytsch |
 |
| Frisch im Amt, zum ersten Mal Gastgeber anläßlich des Hannah-Arendt-Preises: Bürgermeister Carsten Sieling |
Ihr Fazit: "Das einzige, was ich schon immer gewußt habe ein Recht darauf zu haben ist, Lettin zu sein." Solch ein Satz erweckt erst Beifall unter den deutschen Zuhörern als sie fortfährt: "Die Letten sagten zu mir 'Ja, du bist eine von uns!' - allerdings auch der König von Marokko. Als ich dort einen Staatsbesuch machte, wo wir einmal in Marokko gewohnt hatten, da warteten Tausende von Menschen, und auch sie sagten: 'Wir sind so froh, das einmal eine von uns Präsidentin eines anderen Landes werden konnte!'"
Distanz zum Nationalstolz, eine der Grundvoraussetzungen offenbar für das, was sich in Deutschland ein "kritisches Bewußtsein" nennt. Andererseits war diesmal weder Lettlands sehr zögerliche Haltung zur aktuellen Flüchtlingsproblematik, noch die Frage des Zusammenlebens von Letten und Russen ein Thema. Dany Cohn-Bendit, keiner der Ex-Preisträger, aber geladener Podiumsgast zum Thema "Menschenrechte versus Selbstbestimmungsrecht der Völker" (Zitat: "Ich leide an Europa"), fühlte sich offenbar berufen genug um Frau Präsidentin zu ermahnen, den lettischen Anteil am Holocaust an den Juden stärker kritisch zu beleuchten. Eigentlich auch in Lettland kein Tabuthema mehr - und noch 2005 (anläßlich der Bremer Preisverleihung an die Präsidentin) hatten sich sowohl die jüdische Gemeinde in Riga wie auch Margers Vestermanis, Historiker und Holocaust-Überlebender, positiv zu Vīķe-Freiberga's Initiativen zur Aufarbeitung von Nazi-Herrschaft und Holocaust geäussert.
An dieser Stelle fehlte es Frau Ex-Präsidentin etwas an "Centenance", wie man vielleicht sagen könnte. Etwas gar zu verbissen meinte sie nun den "roten Dany" als "Marxist" entlarven zu müssen - was dieser lachend, die Publikumsgunst auf seiner Seite wissend, zurückwies. Kein Paradebeispiel hoher Diskussionskultur - und wie viel Cohn-Bendit abseits der allgemeinen Schlagzeilen wirklich von Lettland weiß - oder sich überhaupt für dieses Land interessiert - blieb ebenfalls offen. Vīķe-Freiberga verstieg sich noch darin, Cohn-Bendit auf die jüdische Beteiligung am Stalinistischen Regime 1939/40 hinweisen zu wollen - hier wurde es fast peinlich, hatte sie doch noch in ihrer eigenen Amtszeit die lettische Historikerkommission ins Leben gerufen, welche die Verbrechen der beiden totalitären Regime in Lettland aufarbeiten soll; über Gerüchte und Verleumdungen gegen Juden ist in den seither jedes Jahr regelmäßig publizierten Kommissionsberichten genügend nachzulesen. Einem schräges Argument ist eben nicht mit einem noch schrägeren Argument zu begegnen - in sofern war der 4.Dezember im ex-präsidialen Tagebuch sicher kein Termin qualitativ hochstehender Diskussion über Lettland damals und heute.
Sehr wechselhaftes Diskussionsniveau also im Bremer Rathaus - der Abstand zur lettischen Innenpolitik ist offenbar nicht so groß; noch nach dem Rücktritt des damaligen Regierungschefs und jetzigem EU-Kommissars Valdis Dombrovskis gab es eine in Umfragen merkbare Anzahl Menschen, die Vaira Vīķe-Freiberga auch als Regierungschefin für tauglich halten - wohl angesichts des Angebots an sonstigen Alternativen. Zwei Tage nach der Bremer Veranstaltung trat in Lettland Laimdota Straujuma zurück. Nein, die immer noch parteilose Ex-Präsidentin wird wohl kein Allheilmittel sein, solange es in Riga vor allem um interne Ränkespiele geht.